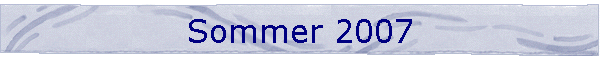BÜRGERBAHN STATT BÖRSENBAHN
RAUBZUG Bahnprivatisierung

Flächenbahn auf dem Abstellgleis?
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Eisenbahn
weitgehend als "altes Eisen". Die Zukunft gehörte dem Auto und dem
Flugzeug. Vor allem dem Auto wurden sozialrevolutionäre Züge angedichtet, so
sei man damit doch endlich "befreit vom Zwang der Fahrpläne"; man könne
"zu jeder Zeit an jeden Ort fahren". Als sich diese Art Freiheit
zunehmend als die Freiheit entpuppte, sich von Stau zu Stau zu bewegen, als es
1973 eine erste "Ölkrise" gab, als die Umweltbewegung sich
entwickelte und als die Städte zunehmend zu Autostädten mutierten, erlebte die
Bahn erstmals ein Revival. Die Rede war davon, dass die Bahn ein
"Unternehmen Zu(g)kunft" sei.
von Winfried Wolf - Die Bahnreform des Jahres
1994 knüpfte an dieser Vision an, drei Ziele wurden für sie ausgegeben:
Erstens. Eine Deutsche Bahn AG kostet die
Steuerzahlenden weniger. Tatsächlich zahlen die Steuerzahlenden heute mit jährlich
rund 13 Milliarden Euro deutlich mehr für den Schienenverkehr als 1993 - bei
weitgehend gleichgebliebenen Verkehrsleistungen. Die DB AG wiederum, die im
Januar 1994 schuldenfrei startete, ist bereits wieder mit 20 Milliarden Euro
verschuldet.
Zweitens. Die neue Bahn sollte eine
kundenfreundliche Bahn, ein "Serviceunternehmen" werden. Dies war
verbunden mit herabsetzenden Formulierungen für die vorausgegangene Bahn als
"Beamtenbahn". Die Realität heute ist, dass die Deutsche Bahn AG bei
Kundenbefragungen zu unterschiedlichen großen Unternehmen hinsichtlich der
Servicequalität meist am schlechtesten abschneidet. In den 13 Jahren von 1994
bis 2006 wurden 5600 km des Streckennetzes abgebaut, rund 500 Bahnhöfe und
mehrere Tausend Schalter geschlossen.
Drittens. Die neue Bahn sollte mehr
Verkehr auf die Schiene bringen. Tatsächlich liegt die absolute Leistung im
Schienenpersonenfernverkehr 2006 noch unter derjenigen des Jahres 1993. Im Güterverkehr
liegt die Leistung leicht über derjenigen des Jahres 1993. Bei den Anteilen am
Verkehrsmarkt gab es jedoch keine Gewinne. Nur im Nahverkehr gibt es absolute
Steigerungen und Anteilsgewinne. Allerdings wurden hier die Subventionen rund
verdoppelt. Gleichzeitig gibt es seit 2005/2006 Beschlüsse der Bundesregierung,
diese Mittel deutlich zu kürzen - was auch zu einem Rückschlag in diesem
einzigen, relativ erfolgreichen Segment des Schienenverkehrs führen wird. Das
Mantra Bahnreform hat ganz offensichtlich die mit ihm verbundenen Erwartungen
nicht erfüllt.
Das Verblüffende ist nun: Es wird keine Bilanz gezogen, weshalb die
Bahnreform ihre Ziele nicht erreicht hat. Stattdessen wird ein neues Mantra
ausgegeben. Dieses lautet: Bahnprivatisierung. Und rein zufällig werden diesem
Projekt - dem sukzessiven Verkauf des 100prozentigen Bundeseigentums an der
Deutschen Bahn AG - die gleichen Ziele verordnet, wie sie zuvor für die
Bahnreform genannt wurden: die neue, teilprivatisierte Bahn soll für die
Steuerzahlenden preiswerter werden, mit ihr soll die Bahn endlich kundennah
operieren und schließlich soll dadurch mehr Verkehr auf die Schiene gebracht
werden. Eine Bahnprivatisierung stellt den größten Raubzug öffentlichen
Eigentums und die größte Zerstörung öffentlicher Daseinsvorsorge der
vergangenen eineinhalb Jahrhunderte dar. Gleichzeitig handelt es sich dabei um
einen der wichtigsten Beiträge zur Klimaverschlechterung. Dies soll auf fünf
Ebenen konkretisiert werden.
Bahnprivatisierung als Ausverkauf und kulturelle Enteignung
Die Eisenbahnen in Deutschland wurden in mehr als 170 Jahren von vier
Generationen und vielen Millionen Menschen durch ihre physische Kraft und durch
enorme öffentliche Mittel aufgebaut. Der Wert der 34.000 km Trassen, der 5.500
Bahnhöfe, der Zehntausende Waggons und der mehr als 2.000 Triebfahrzeuge ist
kaum bezifferbar. Vorsichtige Berechnungen ergeben Werte von 150 bis 250
Milliarden Euro. Die Bundesregierung beabsichtigt mit dem
Bahnprivatisierungsgesetz, die Verfügung über dieses öffentliche Eigentum für
einmalige Einnahmen in Höhe von 5 bis 15 Milliarden Euro aufzugeben. Dieses
Projekt stellt eine gewaltige Verschleuderung öffentlichen Eigentums zugunsten
weniger privater Investoren dar. Gleichzeitig handelt es sich um eine kulturelle
Enteignung: Die Eisenbahnen sind prägend für Regionen und Städte, ein großer
Teil des Schienenverkehrs und der Schieneninfrastruktur wird verschwinden.
Bahnprivatisierung als Abbau der Daseinsvorsorge
Allgemein ist die aktuelle Phase des Kapitalismus von einem umfassenden
Angriff auf das öffentliche Eigentum gekennzeichnet. Alle Formen des
gesellschaftlichen Lebens sollen der direkten Kontrolle des privaten ...
Kapitals und dem Prinzip der Profitmaximierung unterworfen werden. Es ist Zufall
und zugleich wiederum bezeichnend, dass der weltweit größte private
Wasserversorger - derjenige Konzern, der am stärksten von der Zerstörung der öffentlichen
Versorgung mit Wasser profitierte - gleichzeitig dasjenige Unternehmen ist, das
europaweit am stärksten von den Bahnprivatisierungen profitiert: Veolia, im
Bahnbereich bis vor kurzem als Connex unterwegs. Das Bündnis Bahn für Alle
tritt ein für eine Bahn in öffentlichem Eigentum als elementare Voraussetzung
für Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der Mobilität. Mit dem Begriff "öffentliches
Eigentum" wird bewusst ein allgemeiner Rahmen für die Eigentumsform
vorgegeben und nicht allein auf eine "Staatseisenbahn" abgestellt.
Bahnprivatisierung als Teil der fortgesetzten sozialen Ausgrenzung
Die logische Folge jeden Abbaus von Daseinsvorsorge und damit jeder
Unterwerfung dieses Bereichs unter das Prinzip der Profitmaximierung ist eine
wachsende Ausgrenzung von "schwachen" Regionen und "schwachen
" Menschen. Private Investoren müssen, wenn sie die maximale Rendite im
Blick haben, sich auf die rentabelsten Strecken, die rentabelsten Regionen und
die rentabelsten Zeiten der Verkehrsangebote konzentrieren. Die anstehende
Bahnprivatisierung zielt auf Sektoren, die, anders als im Fall des Nahverkehrs,
nicht mit staatlichen Subventionen, die hier für einen gewissen Ausgleich
sorgen, verbunden sind.
Es wird zu einer verstärkten Konzentration auf
Hochgeschwindigkeitsverbindungen kommen, weite Regionen werden keinen
Schienenverkehr mehr haben. Bereits im Zeitraum 1994 bis 2006 wurde das
Schienennetz um 5.500 km (von 39.500 auf 34.000 km) reduziert. Bei der
Bahnprivatisierung ist ein weiterer Abbau um rund 5.000 km "eingepreist".
Im Güterverkehr wird der Prozess des Rückzugs aus der Fläche und des
regionalen Güterverkehrs beschleunigt. Dabei wird eine spezifische und
problematische Struktur der arbeitsteiligen Produktion über weite Distanzen
verstärkt (siehe das Beispiel des Joghurtbechers, in dem viele Tausend
Kilometer
Transportleistungen "stecken "). Anstelle einer Bahn für Alle wird
es eine Bahn für einige geben. Betroffen und in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind damit Menschen bis 18 Jahre, SeniorInnen, finanziell Schwache, ökologisch
Bewusste, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Bahnprivatisierung und die Zerstörung gesellschaftlich sinnvoller Arbeitsplätze
Die Arbeitsplätze im Bereich Schiene haben sich von knapp 400.000 Ende 1993
auf 180.000 2006 halbiert. Im Fall einer Bahnprivatisierung ist mit einem
weiteren Abbau von vielen Zehntausend Arbeitsplätzen zu rechnen. Gleichzeitig
gibt es eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Nochbeschäftigten
(vermehrter Arbeitsstress, Outsourcing, Teilzeitarbeit). Ergänzend droht der
Abbau von Arbeitsplätzen im Bereich der Bahntechnik, denn jeder private
Investor wird darauf drängen, den "Kostenfaktor Arbeit" immer weiter
zu reduzieren.
Arbeitsplatzabbau, Prekarisierung und Entwertung der Arbeit bringen einen
weiteren Abbau bei der Servicequalität. Es werde inzwischen elementare
Standards bei der Sicherheit im Schienenverkehr tangiert. Die Serie schwerer
Eisenbahnunglücke, die es Ende der 1990er bei den britischen Bahnen gab, werden
von den meisten Beobachtern im Zusammenhang mit der Privatisierung von British
Rail und dem damit einhergehenden Abbau von Arbeitsplätzen bzw. dem Zerreißen
elementarer Arbeitszusammenhänge gesehen.
Hier springt ein Widerspruch in der öffentlichen Debatte ins Auge. Bei der
Bahn heißt es, ein radikaler Abbau von Arbeitsplätzen sei eine Sparmassnahme,
hier würden "Produktivitätsgewinne" erzielt und im übrigen müsse
der Staat sich "aus der Wirtschaft" heraushalten. Im Fall der
Airbus-Krise jedoch gab es eine breite, auch öffentlich getragene Mobilisierung
zum Erhalt der Arbeitsplätze und aller Standorte; dies sei erforderlich, um den
"Technologie- Standort Deutschland" zu verteidigen. Gleichzeitig wurde
beschlossen, dass sich der Staat engagiert. Dass der Schienenverkehr ökologisch
und umweltpolitisch sinnvoller ist als die Luftfahrt im allgemeinen oder gar der
Megaliner A380 ist jedoch unbestritten.
Bahnprivatisierung und Umwelt- und Klimazerstörung
Alle Modelle einer Bahnprivatisierung gehen davon aus, dass der Anteil der
Schiene im Fernverkehr, wo sich z.B. die weitgehende Abschaffung der Zuggattung
InterCity/ EuroCity abzeichnet, weiter sinkt und im Nahverkehr bestenfalls
erhalten werden kann. Im Güterverkehr soll es vor allem im Segment der
Transporte über weite Entfernungen Gewinne geben können. In der aktuellen
Situation wäre jedoch bereits aus klimapolitischen Gründen eine Verkehrswende
mit einer deutlichen Stärkung der Schiene im Verkehrsmarkt und zumindest einem
Stopp für jede Ausweitung des Straßen- und des Luftverkehrs erforderlich. Die
Bahnprivatisierung bewirkt jedoch das Gegenteil.
Was sind die Gründe für die Bahnprivatisierung?
Die sozialen, strukturpolitischen und umweltpolitischen Gründe, die gegen
eine Bahnprivatisierung sprechen sind weitreichend und überzeugend. Fragt man,
warum dennoch die Bahnprivatisierungen weltweit vorangetrieben werden, dann
bleiben nur zwei grundsätzliche Antworten: Zum einen geht es um den Zwang,
alles der direkten Kontrolle des privaten Kapitals zu unterwerfen, auch wenn
dies sozialen und - auch aus bürgerlicher Sicht - rationalen Überlegungen
widerspricht. Zum anderen resultieren diese Zwänge auch aus der konkreten
Struktur des großen Kapitals: Unter den 100 größten Konzerne der Welt sind
die Öl-, Auto- und Flugzeugbaukonzerne die mit Abstand stärkste Gruppe.

Noch Fragen? Der Stern über dem Stuttgarter
Hauptbahnhof als Symbol für die Prioritäten der Verkehrspolitik...
Unternehmen, die mit Öl und seinen Derivaten (Benzin, Diesel, Kerosin,
Flugbenzin und Bunkeröl) verbunden sind, sind tonangebend - grundsätzlich und
natürlich besonders im internationalen Verkehrssektor. In Großbritannien sind
heute maßgebliche Betreiber der privatisierten Bahnen die Unternehmen Virgin
(Billigflieger) und Stage Coach bzw. Arriva (zwei Unternehmen, die europaweit
Busverkehre organisieren). Es liegt auf der Hand, dass eine Teilprivatisierung
der DB AG auch Investoren anlocken wird, die überwiegend Interessen vertreten,
die nicht im Einklang mit dem Ziel einer Flächenbahn stehen. Hier wird in jüngerer
Zeit der Name Gazprom als Interessent für einen Einstieg bei der DB AG genannt.
Um welche Art Bahnprivatisierung geht es konkret?
Ein Teil der bahnfreundlichen Szene - so die Führungen des Fahrgastverband
pro Bahn, des VCD und die Grünen als Partei - propagiert ein Modell, wonach die
Infrastruktur (Netz und Bahnhöfe) in Bundeseigentum bleiben und der Bahnbetrieb
privatisiert werden soll. Man verspricht sich dabei einen "belebenden
Wettbewerb", der den Fahrgästen zu Gute kommen würde.
Dagegen müssen zunächst drei immanente Argumente angeführt werden. Erstens
wird jeder private Bahnbetreiber auf einer Rendite von mindestens 10 Prozent
bestehen und damit weit mehr aus den Fahrgästen, den Beschäftigten und den
Steuerzahlenden "herausholen" als dies bei einem Betrieb in öffentlichem
Eigentum der Fall ist. Tatsächlich reduziert sich der "Wettbewerb"
bei den Ausschreibungen im Bahnverkehr bereits weitgehend auf die Frage, welcher
Bieter die Lohnkosten am stärksten drücken kann. Zweitens wird jede Ausweitung
des "Wettbewerbs " auf der Schiene zu einem immer bunteren
"Flickenteppich" bei den Tarifen, dem Fahrplan und bei den Standards für
Sicherheit und Service führen. Drittens gab es in 170 Jahren Eisenbahnen nie
ein erfolgreiches Modell dieser Art von staatlichem Netz und privatem Betrieb
bzw. dort, wo dies praktiziert wird, ist das Ergebnis auf mittlere Sicht ein
Desaster.
In Großbritannien gibt es seit nunmehr fünf Jahren just ein solches
"Trennungsmodell": das Netz ist - nach der Pleite des privaten
Infrastrukturbetreibers Railtrack - seit Ende 2001 wieder in staatlichem
Eigentum; der Betrieb wird weiter von knapp zwei Dutzend privaten "TOUs",
train operating units, realisiert. Allgemein wird das Desaster im britischen
Bahnverkehr im schlechten Service der privaten Betreiber, in den hohen
Fahrpreisen, in dem Flickenteppich bei Tarifen und Fahrplan und in der großen
Zahl von schweren Bahnunfällen, die im Zusammenhang mit der Trennung von Netz
und Bahnverkehr stehen, gesehen. Alle britischen Parteien fordern inzwischen
eine neuerliche "Integration" von Verkehr und Infrastruktur.
Doch neben diesen immanenten Kritikpunkten gibt es einen grundsätzlichen
Aspekt: Dieses Modell steht nirgendwo in der politischen Landschaft zur Debatte.
Zur Debatte steht ausschließlich ein konkretes Bahnprivatisierungsgesetz, das
faktisch auf die Privatisierung von Bahnverkehr und Schieneninfrastruktur
hinausläuft. Der im März 2007 vorgelegte Entwurf eines
Bahnprivatisierungsgesetzes aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Tiefensee lässt
sich in vier Punkten zusammenfassen:
1. Das bisher 100-prozentige Eigentum des Bundes an der DB AG wird (zunächst)
bis zu 49 Prozent an Investoren verkauft. 2. Trassen und Bahnhöfe bleiben
formal zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Doch der Bund tritt faktisch alle
Rechte, die aus diesem Eigentum resultieren, für 15 Jahre an die
teilprivatisierte DB AG ab. Die DB AG "betreibt und bilanziert die
Infrastruktur". 3. Nach 15 Jahren erhält die DB AG auch die formellen
Eigentumsrechte an der Infrastruktur, es sei denn, der Bund zahlt der DB AG
einen sehr hohen Milliarden-Euro- Betrag. 4. Nach der Teilprivatisierung zahlt
der Bund weiterhin jährlich rund 12 Milliarden Euro an Unterstützungszahlungen
für das System Schiene (Instandhaltung, Neubau, Regionalisierungsmittel,
Beamte-Ausgleichszahlungen). Diese Gelder dienen nun zunehmend der Alimentierung
privater Investoren.
Der einzige Vorteil des Bundes bei diesem Ausverkauf ist der einmalige Betrag
in einstelliger Milliardenhöhe beim Anteilsverkauf an Investoren.
In dieser Situation müsste bei all denen, die hierzulande zukünftig auf die
Option Schiene setzen, alles getan werden, um dieses Bahnausverkaufs-Gesetz zu
verhindern. Hierfür könnte ein breites Bündnis geschlossen werden, das
diejenigen erfasst, die jede Art Bahnprivatisierung ablehnen - wie dies das Bündnis
"Bahn für Alle" tut -, und diejenigen, die dafür eintreten, dass nur
die Infrastruktur im Eigentum des Bundes bleibt, die bisher aber auch viele gute
Gründe dafür anführten, dass eine Privatisierung des "integrierten
Unternehmens" katastrophale Folgen haben würde. Wer sich in dieser
Situation jedoch weigert, sich für ein solches Bündnis zu engagieren, muss
sich den Vorwurf gefallen lassen, den folgenschweren Ausverkauf zuzulassen.
Strukturelemente einer Bahn für Alle
Die Privatisierungsanhänger haben ein Plus in der öffentlichen Debatte:
Wird der Zustand der real existierenden Deutschen Bahn AG als Beispiel für eine
Bahn in öffentlichem Eigentum genommen, dann sagen sich viele: Es kann ja nur
besser werden. Daher ist es wichtig, einen "status quo plus"
entwickeln. Die fünf Strukturelemente einer überzeugenden Bahn könnten wie
folgt aussehen:
Grundsätzlich müsste es sich um eine Bahn in öffentlichem Eigentum
handeln. Dabei könnte es sich jedoch um eine Kombination dieses öffentlichen
Eigentums auf unterschiedlichen Ebenen handeln (Kreisbahnen, Länderbahnen,
Bundesbahn). Die Erfolge einiger neuer Bahnen, die im Rahmen der
Regionalisierung entstanden, sind in erster Linie auf ihre Dezentralität und
auf ihre relative Bürgernähe zurückzuführen; einige davon sind Bahnen in öffentlichem
Eigentum (z.B. die Usedomer Bäderbahn als Tochter der DB AG, die Karlsruher
Verkehrsbetriebe, die sich im Eigentum der Stadt Karlsruhe befinden und die in
einem Umkreis von bis zu 100 km Teile des Schwarzwaldes erschließen oder die
Gaisbockbahn in Oberschwaben, deren Eigentümerin der Bodenseekreis ist).
Wichtig ist dabei allerdings, dass diese Bahnen in ein einheitliches System von
Fahrplan und Tarifen und den Standards für Sicherheit und Service eingebunden
sind.
Das zweite Elemente dieser Bahn für alle besteht im Konzept einer Flächenbahn
anstelle einer Konzentration auf Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Alle Regionen
müssen mit der Schiene erreichbar, alle Oberzentren an die Schiene angebunden
sein. Rund 10.000 km Schiene müssten neu erbaut bzw. überwiegend reaktiviert
werden. Das dritte Element heißt Personalausbau: Ein erfolgreiches
Dienstleistungsunternehmen muss mit Menschen werben. Die erwähnte, äußerst
erfolgreiche Usedomer Bäderbahn verfolgt das Konzept: nirgendwo ein Automat, überall
Personal an den Bahnhöfen und den Schaltern.
Viertens ist ein Bahnmanagement erforderlich, das aus dem Metier kommt und
sich für die Bahn engagiert.
Fünftens schließlich müsste diese Bahn für Alle in Zeiten des
Klimawandels den unschätzbaren Vorteil ausspielen, dass die Schiene das einzig
motorisierte Verkehrsmittel ist, das in relativ kurzer Zeit ganz oder überwiegend
mit alternativer - nachhaltiger - Energie betrieben werden kann. Mit Strom aus
Solarenergie, Gezeitenkraftwerken, Windkraft und Kraftstoffen aus nachwachsenden
Rohstoffen.
Utopie? Das Modell einer alternativen Bahn existiert bereits weitgehend - in
Gestalt der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Auf sie treffen die ersten vier
der oben genannten Strukturelemente zu. Und diese überzeugende und luxuriöse
Form des Bahnverkehrs, die im Vergleich zum deutschen Schienenverkehr mit einem
Drittel der Subventionen je gefahrenen Personen- oder Tonnenkilometer auskommt,
wird in unserem südlichen Nachbarland noch unter besonders schwierigen
Bedingungen realisiert (Bahnverkehr von 350 bis 1.500m über dem Meeresspiegel,
maximale Distanzen mit 500 km, im Winter weit tiefere Minusgrade).

Winfried Wolf ist als Sprecher der Bahnfachleutegruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn
maßgeblich am Aktionsbündnis Bahn für Alle beteiligt. Zu diesem haben sich
Attac, BUND, Bürgerbahn statt Börsenbahn (BsB), Bahn von unten (in Transnet),
Eurosolar, Grüne Jugend (Bundesverband), Robin Wood, Naturfreunde, Umkehr e.V.,
der VCD Landesverband Brandenburg und Ver.di zusammengeschlossen. Wichtige
Instrumente der Kampagne sind das Faltblatt "Ihr Reiseplan Höchste
Eisenbahn - Stoppt den Börsenwahn!" (ideal zum Verteilen in Zügen!) und
der Film "Bahn unterm Hammer" (Kern Film), der auch als DVD zu
beziehen ist. Jüngste Veröffentlichungen von Winfried Wolf zu diesem Thema:
"In den letzten Zügen - Bürgerbahn statt Börsenwahn" (Hamburg 2006,
VSA) und "Verkehr - Umwelt - Klima. Die Globalisierung des
Tempowahns", Wien Herbst 2007 (Promedia).
Infos unter: www.DeineBahn.de,
www.bahn-unterm-hammer.de
bzw. Tel.: (0 69) 90 02 81 40.
Der Bahnspott
die macht privat die Bahn. Sehenswerte 25 Sekunden unter: www.gofish.com/player.gfp?gfid=30-1101026