Monatszeitung für Selbstorganisation
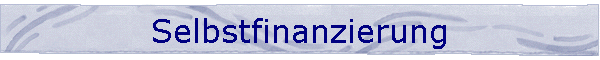
|
|
Organisationsmodell:Von Direktkrediten zur ÖkobankWer kennt das nicht. das x-te Plenum, bei dem die fehlende Kohle zentral auf der Tagesordnung steht. Und immer dieselbe Leier. Der Betrieb hat zwar nicht schlecht gewirtschaftet, aber dazu, die fälligen Kredite zurückzuzahlen, dazu reicht’s einfach wieder mal nicht. Also wieder umschulden.
 Aber was man sich auch immer einfallen läßt: weder die Freunde noch deren
Freunde und auch nicht die Kunden haben die Möglichkeit, über längere Zeit auf ihre
Ersparnisse zu verzichten. Das neue Auto, die Wohnungseinrichtung, der Urlaub oder der
Start ins lange geplante eigene Projekt - Sparen ist nicht Selbstzweck und wir zählen
nicht gerade die Millionäre zu unserem Bekanntenkreis.
So entwickelt sich ein neuer
Arbeitsplatz im Kollektiv: der Kreditjongleur. Er sitzt meistens im Büro vor Bergen von
Rechnungen und überlegt, wen man nach der dritten Mahnung noch mit Ratenzahlungen
vertrösten kann. Ansonsten macht er Druck im Plenum: wo kriegen wir neue Kredite
her?
Und mit dieser allseits
gefürchteten Frage verwickeln sich die sowieso vorhandenen Probleme untereinander zum
Gordischen Knoten: wieso schaffst Du eigentlich nicht mal einen Kredit bei, schließlich
engagierst du dich sonst auch nicht gerade übermäßig und daß du in so 'ner Situation
in Urlaub gefahren bist, das werden wir auch nicht vergessen... So und so ähnlich, und
das hin und zurück.
Am Anfang ist das ja noch
reizvoll, die scheinbar ausweglose Situation mit immer neuen Tricks und Einfällen immer
wieder doch zu meistern. Aber nach drei, fünf oder mehr Jahren und nach dem Verschleiß
von drei, fünf oder mehr hoffnungsfrohen Finanzierungsjongleuren ist man doch irgendwann
so weit, den Sinn des Ganzen in frage zu stellen.
Ich möchte nicht wissen,
wie viele Kollektive an dieser Frage irgendwann mal entnervt und zerstritten aufgegeben
haben. Ich weiß aber, daß das traditionelle Spiel zunehmend aussichtsloser wird.
Einerseits wird der Finanz- und Kreditbedarf der Kollektive größer, zum anderen ist der
Kreis der auf Kredite Ansprechbaren nach Jahren einfach erschöpft - das Spiel wird zum
Trauerspiel.
Es ist von daher mehr als
erfreulich, daß seit gut einem Jahr innerhalb unserer Bewegung Ansätze entwickelt
werden, dieses Kreditierungsproblem aus den Zufälligkeiten und Unzulänglichkeiten raus
in eine organisierte und handhabbare Form zu bringen. Das ist zunächst der von Stattwerke
in Berlin entwickelte und mittlerweile von den meisten regionalen Netzwerken übernommene
Ansatz der Direktkredit-Vermittlung.
Dabei geht es im Prinzip um
die Vermittlung des Kontakts zwischen Zentren, die Geld haben und mit selbstverwalteten
Betrieben sympathisieren, d.h. diesen ihr Geld befristet zur Verfügung stellen würden,
statt es zur Bank zu tragen - und den Betrieben, die solche Kredite brauchen.
In der Praxis handelt es
sich um eine bundesweit durchgeführte Kampagne, bei der solchen potentiellen Kreditgebern
die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit dieses ,,alternativen Sparens" deutlich gemacht
wird. In der Tat wird ja nicht nur etwas sinnvolles finanziert - der Aufbau einer am
Menschen orientierten Wirtschaft - sondern zusätzlich Schädliches verhindert. Die Banken
,,arbeiten" mit dem Spargeld, und am meisten ist allemal zu verdienen in
Spekulationsgeschäften und in der Rüstung. Derzeit gibt’s - glaube ich - die
höchsten Zinsen überhaupt bei amerikanischen Staatsanleihen. Und was der Reagan mit der
Kohle macht, ist allgemein bekannt.
Finden sich nun
,,Alternativ-SparWillige" so wird deren Kredit erst mal auf einem Treuhandkonto
,,geparkt"; dies solange, bis das regionale Vermittlungsbüro dem Kreditgeber einen
selbstverwalteten Betrieb präsentieren kann, den dieser kreditieren möchte. Das
Vermittlungsbüro muß also parallel zur Geldsammelkampagne einen Katalog
selbstverwalteter Betriebe erstellen mit den entsprechenden Selbstdarstellungen und mit
den Beschreibungen der jeweiligen Investitionsvorhaben.
Der Rest ist dann relativ
einfach. Der potentielle Kreditgeber wird mit dem Betrieb seiner Wahl zusammengebracht;
zwischen Kreditgeber und Betrieb werden die Kreditbedingungen(Laufzeit, Zinsen,
Sicherheiten) ausgehandelt und vertraglich abgesichert; das Direktkredit-Vermittlungsbüro
erhält für seine Tätigkeit einen Prozentsatz der vermittelten Summe (0,5 bis 1%).
Ganz wichtig dabei ist noch,
daß die Kreditvermittlung nicht als bloße Finanztransaktion verstanden wird, sondern
verbunden ist mit intensiver Beratungstätigkeit. Die Vermittler brauchen dazu
entsprechende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, genügend Überblick über den Markt, um
die Chancen des betrieblichen Vorhabens einschätzen zu können und vor allem
weitreichende Kenntnisse des Innenlebens selbstverwalteter Betriebe und der Situation der
Gesamtheit der Betriebe in der Region. Kenntnis des Innenlebens deshalb, um die Sicherheit
der Rückzahlung einschätzen zu können (dingliche Sicherheiten fehlen in der Regel),
Kenntnis der gesamten Szene deshalb, weil der an einen Betrieb vermittelte Kredit und die
damit getätigte Investition bei insgesamt enger werdendem Markt schnell dazu führen
kann, daß andere selbstverwaltete Betriebe der gleichen Branche in Wettbewerbsnachteile
und möglicherweise ins Schleudern geraten. - Soviel zunächst zur
Direktkreditvermittlung.
Die Vorteile gegenüber der
oben geschilderten Situation des betriebsbezogenen Kreditmanagements liegen auf der Hand: Aber was man sich auch immer einfallen läßt: weder die Freunde noch deren
Freunde und auch nicht die Kunden haben die Möglichkeit, über längere Zeit auf ihre
Ersparnisse zu verzichten. Das neue Auto, die Wohnungseinrichtung, der Urlaub oder der
Start ins lange geplante eigene Projekt - Sparen ist nicht Selbstzweck und wir zählen
nicht gerade die Millionäre zu unserem Bekanntenkreis.
So entwickelt sich ein neuer
Arbeitsplatz im Kollektiv: der Kreditjongleur. Er sitzt meistens im Büro vor Bergen von
Rechnungen und überlegt, wen man nach der dritten Mahnung noch mit Ratenzahlungen
vertrösten kann. Ansonsten macht er Druck im Plenum: wo kriegen wir neue Kredite
her?
Und mit dieser allseits
gefürchteten Frage verwickeln sich die sowieso vorhandenen Probleme untereinander zum
Gordischen Knoten: wieso schaffst Du eigentlich nicht mal einen Kredit bei, schließlich
engagierst du dich sonst auch nicht gerade übermäßig und daß du in so 'ner Situation
in Urlaub gefahren bist, das werden wir auch nicht vergessen... So und so ähnlich, und
das hin und zurück.
Am Anfang ist das ja noch
reizvoll, die scheinbar ausweglose Situation mit immer neuen Tricks und Einfällen immer
wieder doch zu meistern. Aber nach drei, fünf oder mehr Jahren und nach dem Verschleiß
von drei, fünf oder mehr hoffnungsfrohen Finanzierungsjongleuren ist man doch irgendwann
so weit, den Sinn des Ganzen in frage zu stellen.
Ich möchte nicht wissen,
wie viele Kollektive an dieser Frage irgendwann mal entnervt und zerstritten aufgegeben
haben. Ich weiß aber, daß das traditionelle Spiel zunehmend aussichtsloser wird.
Einerseits wird der Finanz- und Kreditbedarf der Kollektive größer, zum anderen ist der
Kreis der auf Kredite Ansprechbaren nach Jahren einfach erschöpft - das Spiel wird zum
Trauerspiel.
Es ist von daher mehr als
erfreulich, daß seit gut einem Jahr innerhalb unserer Bewegung Ansätze entwickelt
werden, dieses Kreditierungsproblem aus den Zufälligkeiten und Unzulänglichkeiten raus
in eine organisierte und handhabbare Form zu bringen. Das ist zunächst der von Stattwerke
in Berlin entwickelte und mittlerweile von den meisten regionalen Netzwerken übernommene
Ansatz der Direktkredit-Vermittlung.
Dabei geht es im Prinzip um
die Vermittlung des Kontakts zwischen Zentren, die Geld haben und mit selbstverwalteten
Betrieben sympathisieren, d.h. diesen ihr Geld befristet zur Verfügung stellen würden,
statt es zur Bank zu tragen - und den Betrieben, die solche Kredite brauchen.
In der Praxis handelt es
sich um eine bundesweit durchgeführte Kampagne, bei der solchen potentiellen Kreditgebern
die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit dieses ,,alternativen Sparens" deutlich gemacht
wird. In der Tat wird ja nicht nur etwas sinnvolles finanziert - der Aufbau einer am
Menschen orientierten Wirtschaft - sondern zusätzlich Schädliches verhindert. Die Banken
,,arbeiten" mit dem Spargeld, und am meisten ist allemal zu verdienen in
Spekulationsgeschäften und in der Rüstung. Derzeit gibt’s - glaube ich - die
höchsten Zinsen überhaupt bei amerikanischen Staatsanleihen. Und was der Reagan mit der
Kohle macht, ist allgemein bekannt.
Finden sich nun
,,Alternativ-SparWillige" so wird deren Kredit erst mal auf einem Treuhandkonto
,,geparkt"; dies solange, bis das regionale Vermittlungsbüro dem Kreditgeber einen
selbstverwalteten Betrieb präsentieren kann, den dieser kreditieren möchte. Das
Vermittlungsbüro muß also parallel zur Geldsammelkampagne einen Katalog
selbstverwalteter Betriebe erstellen mit den entsprechenden Selbstdarstellungen und mit
den Beschreibungen der jeweiligen Investitionsvorhaben.
Der Rest ist dann relativ
einfach. Der potentielle Kreditgeber wird mit dem Betrieb seiner Wahl zusammengebracht;
zwischen Kreditgeber und Betrieb werden die Kreditbedingungen(Laufzeit, Zinsen,
Sicherheiten) ausgehandelt und vertraglich abgesichert; das Direktkredit-Vermittlungsbüro
erhält für seine Tätigkeit einen Prozentsatz der vermittelten Summe (0,5 bis 1%).
Ganz wichtig dabei ist noch,
daß die Kreditvermittlung nicht als bloße Finanztransaktion verstanden wird, sondern
verbunden ist mit intensiver Beratungstätigkeit. Die Vermittler brauchen dazu
entsprechende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, genügend Überblick über den Markt, um
die Chancen des betrieblichen Vorhabens einschätzen zu können und vor allem
weitreichende Kenntnisse des Innenlebens selbstverwalteter Betriebe und der Situation der
Gesamtheit der Betriebe in der Region. Kenntnis des Innenlebens deshalb, um die Sicherheit
der Rückzahlung einschätzen zu können (dingliche Sicherheiten fehlen in der Regel),
Kenntnis der gesamten Szene deshalb, weil der an einen Betrieb vermittelte Kredit und die
damit getätigte Investition bei insgesamt enger werdendem Markt schnell dazu führen
kann, daß andere selbstverwaltete Betriebe der gleichen Branche in Wettbewerbsnachteile
und möglicherweise ins Schleudern geraten. - Soviel zunächst zur
Direktkreditvermittlung.
Die Vorteile gegenüber der
oben geschilderten Situation des betriebsbezogenen Kreditmanagements liegen auf der Hand:
Dennoch reicht das neu geschaffene Instrumentarium der DirektkreditVermittlung nicht aus, die Finanzierungsprobleme der Betriebe zu lösen. Es handelt sich nach wie vor um Kurzzeit-Kredite, d.h. die Tilgungslasten sind in der Regel hoch. Die Entscheidung verbleibt beim Kreditgeber, d.h. es kann einem Betrieb auch passieren, daß er keinerlei Kredit kriegt, obwohl er die Voraussetzungen in gleicher Weise wie alle anderen erfüllt. Besonders problematisch wird das bei notwendigen Folgekrediten. Immobilien und andere Großvorhaben sind nur schwer zu finanzieren, weil es dabei immer um lange Laufzeiten geht und nur große Summen, d.h. eine Vielzahl von Kreditgebern muß für solche Projekte gewonnen werden. Und der gewichtigste Einwand schließlich aus der Stattwerke-Praxis des letzten Jahres: es kommt insgesamt nicht genug Geld zusammen, die Mentalität des deutschen Sparers verlangt nach Sicherheiten und nach einem Modus der Abwicklung, den er kennt und in dem er solche Sicherheit vermutet. Aus dieser Erfahrung leitet sich logisch ab die Entwicklung von Instrumenten, die die Sicherheit gewährleisten können und die Entwicklung einer eigenen Bank, die über diesen Status und die damit gegebenen Möglichkeiten allseits vertrauter Abwicklung Seriösität und Sicherheit garantiert. Gegründet werden sollen sog. Kredit-Garantie-Gemeinschaften. Dies sind Einrichtungen, die nach dem Kreditwesengesetz (KWG) funktionieren, aber nicht wie Banken Geld verleihen, sondern dem Kreditnehmer die notwendigen Bürgschaften zur Verfügung stellen, damit er bei der ,,Hausbank" den gewünschten Kredit auch kriegen kann. Gespeist werden solche Kreditgarantiegemeinschaften aus Mitteln der öffentlichen Hand, aus halbstaatlichen Mitteln und aus Eigenbeiträgen der beteiligten Betriebe. Es gibt solche KGGs in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und des Handels (angeblich um die 350 KGGs in der BRD). Nicht selten werden sie genutzt, um ,,verdeckt" zu subventionieren, indem zusätzliche Rückbürgschaften des Landes gewährt und die Verluste der jeweiligen KGG damit (= aus Steuergeldern) immer wieder ausgeglichen werden. Eine Kreditgarantiegemeinschaf kann nach dem KWG Bürgschaften leisten bis zum 18-fachen ihres Einlagenkapitals. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: in Hessen wird die Gesamtheit der Betriebe als Verein (Verband) zu 100% Besitzer de KGG für Selbstverwaltung GmbH. Diese erhält ihr Betriebskapital von 2 Mio. Mark als einmalige Zuwendung aus Landesmitteln (wird derzeit verhandelt im sog. ,,7-Mio Programm"). Danach sind die hessischen Betriebe in der Lage, mit diesem Instrument, bei dem nur sie selbst das Sagen haben, Kredite zu verbürgen bis zur Gesamthöhe von 36 Mio. Mark (wobei die Bankenaufsicht am Anfang mit Hinweis auf das angeblich erhöhte Risiko bei Krediten von selbstverwalteten Betrieben den Multiplikator 18 sicherlich auf 10 oder sogar 5 herunterschrauben wird; aber auch das bleibt dann noch eine bedeutende Manövriermasse). In Berlin gibt's (noch) kein 7-Mio-Programm, aber auch dort stehen die Chancen zur Gründung einer KGG Selbstverwaltung nicht schlecht. Hier ist - soweit ich weiß - die Kirche bereit, einen größeren Betrag beizusteuern. Das hessische Modell - hoffen wir - wird Pilotfunktion für andere Bundesländer haben, so daß in zwei, drei Jahren auf Länderebene überall solche Kreditgarantiegemeinschaften für den selbstverwalteten Bereich existieren. Schwieriger zu bewerkstelligen ist die Sache, die das gesamte Selbstfinanzierungskonzept abrundet und zu einer hieb- und stichfesten Angelegenheit macht: die Gründung der eigenen (Öko-)Bank. Sie soll die Bank werden, über die die gesamte Bewegung ihre Finanzierungsgeschäfte abwickelt. Die Summe der Finanztransaktionen, d.h. der Kredite, der Spargelder usw. aller Leute, die sich „zur Bewegung" zählen ist - da braucht man nicht hochzustapeln - enorm. Und an allen diesen Geschäften verdienen die Banken, d.h. genau die, die am allerwenigsten Interesse daran haben, daß sich die Gesellschaft in der von uns gewünschten Richtung verändert. In dem Moment, wo wir mit Geld umgehen, stabilisieren wir also das System, das wir bekämpfen. Und dies deshalb, weil es keine Alternative gibt. Die Alternative zu Geldgeschäften überhaupt wird es wohl auch auf längere Sicht nicht geben. Eine Alternative zu den bestehenden Banken zu schaffen aber liegt in unseren Möglichkeiten. Motto: man nehme, nämlich 6 Mio. Mark Eigenkapital und zwei befugte Bankleiter und beantrage damit die Zulassung als Geschäftsbank. Dieser Antrag wird das Bundesaufsichtsamt für das Bankwesen sicher irritieren - verhindern wird es die Bankgründung letztlich aber nicht können. Irritiert reagieren werden noch andere, vor allem der genossenschaftliche Prüfungsverband, weil diese Bank als Genossenschaftsbank gegründet werden soll, wodurch die Spargelder der Öko-Bank über den Sicherungsfonds der Genossenschaftsbanken abgesichert sind, und den Öko-Bank-Sparkunden die Teilnahme am ,,freizügigen Sparverkehr" der Genossenschaftsbanken ermöglicht wird. Dies ist eine sehr wichtige Geschichte, gestattet es doch den Öko-Bank-Sparern, bei jeder Volksbank, Sparkasse oder Raiffeisenkasse das Öko-Bank-Sparbuch zu führen, d.h. Einzahlungen zu leisten und Abhebungen zu tätigen. Der Öko-Bank-Sparer hat also die Filiale vor Ort, die er braucht, ohne daß die Öko-Bank gezwungen wäre, gleich überall kostspielige Filialen selbst zu unterhalten. Mit dem genossenschaftlichen Prüfungsverband haben - habe ich mir sagen lassen - sowieso noch einige von uns ein Hühnchen zu rupfen. Die zu erwartende Verschleppung oder versuchte Verhinderung des Aufnahmeantrages der Öko-Bank-Genossenschaft könnte ein erster Punkt sein, einmal gemeinsam ernsthaft mit dem Dachverband der Genossenschaften umzugehen. So viel in Kürze zu den Zulassungsschwierigkeiten. Aber soweit ist die Sache noch lange nicht. Die Schwierigkeiten vorher liegen auf zwei Ebenen: die Beschaffung der 6 Mio. Einlagekapital, und die Entwicklung einer tragfähigen ,,Infrastruktur" für die Bank. Zunächst mal diesen letzten Punkt: Die Öko-Bank soll die Bank der Bewegung werden, und d.h. sie darf nicht von einigen Managern einfach in die Landschaft gepflanzt werden, sondern muß von einer möglichst breiten Basis entwickelt und kontrolliert werden. Die ,,Bank der Bewegung" soll also keine Bank für die Bewegung werden (das auch), sondern eine, die ,,Bewegung in die Bewegung bringt", d.h. Diskussionsprozesse in Gang setzt und aktives Engagement produziert und umgekehrt ihre konkrete Ausgestaltung über gerade diese Diskussionsprozesse erfährt. Die Öko-Bank also als ,,bewegte Bank", wie es Michael Makowski formuliert. Der Lieblingsgedanke der Stattwerke ist eine Öko-Bank, die über breite Diskussionsprozesse und verstärktes Engagement der Betroffenen und Interessierten vor Ort so dezentral ausgestaltet werden kann, daß das zentralistische Element sich auf rein verwalterische bürokratische Funktion beschränkt. Also: in Frankfurt zwar ,,die Zentrale" in Form des Computers und der Verwaltung, die lebendige Bank hingegen in den Regionen in der Form von sog. ,,Finanzkooperativen", ausgestattet mit weitreichender Vollmacht und Autonomie. Wie kann man sich das vorstellen? In den Regionen bilden sich Vereine, in denen sich alle die zusammenfinden, die Ernst machen wollen mit der Veränderung der Gesellschaft und erkannt haben, wie wichtig dafür ein autonomes Finanzierungsinstrument ist. Das sind sowohl Kapitalgeber als auch die potentiellen Kreditnehmer (d.h. die Betriebe), es sind Leute ,,vom Fach" (Banker und Betriebsberater) und es sind Vertreter der relevanten politischen Strömungen. Diese Vereine leisten zweierlei: Sie bringen Spenden- und andere Gelder auf als Betriebskapital für eine GmbH, die sie zu 100% besitzen. Sie führen die Diskussion um Vergabekriterien, die derjeweiligen Region angemessen sind. Sieben oder mehr solcher Finanzkooperativen gründen mit den Geschäftsanteilen ihrer GmbH's dann die Öko-Bank-Genossenschaft. Ein fachlich qualifiziertes Mitglied der Finanzkooperative wird nunmehr umgekehrt von der Öko-Bank eG mit Prokura ausgestattet, ist also formal Angestellter der Bank, womit die rechtliche Seite der Angelegenheit sichergestellt ist. De facto aber - das dürfte klar geworden sein - ist dieser Prokurist seit Jahren eingebunden in die Diskussion der Region, in der er arbeitet. Er steht genau dort unter Kontrolle und Rechtfertigungszwang. Ich muß sagen, daß ich mit dieser Vorstellung ausgesprochen sympathisiere und hoffe, daß sie nicht auf rechtliche Verhinderungsgründe stößt oder allzu große Schwierigkeiten in der Handhabung auftreten. Initiativen zur Gründung solcher Finanzkooperativen werden derzeit vorbereitet oder schon konkret angegangen von einigen der regionalen Netzwerke. In der Zwischenzeit und damit komme ich zum anderen großen Problem - arbeitet der in Frankfurt gegründete Verein Freunde und Förderer der Öko-Bank e. V. weiter, bis die Finanzkooperativen existieren und das Konzept auf rechtliche und praktische Durchführbarkeit hin überprüft worden ist. Es geht ganz zentral um das Aufbringen der 6 Mio. Mark, des erforderlichen Eigenkapitals zur Bank-Gründung, die in Anteilen von 100 Mark auf ein Treuhandkonto gesammelt werden. 6 Mio. Mark - das ist immens viel (der Herstatt gehört dafür geprügelt), und doch heißt es, auf den Kreis der bundesweit zu Interessierenden bezogen, auch wieder nicht so viel. 60.000 Personen, die sich mit 100 Mark beteiligen oder 30.000 mit 200, und der Käs' ist gegessen. Das Problem besteht darin, diese 30.000 oder 60.000 überhaupt zu erreichen, um ihnen die Idee nahebringen zu können. Werbung über Zeitungen ist teuer und der Versand der Informationsmaterialien, von zwei oder drei Stellen aus bundesweit, verschlingt Unsummen. Außerdem ist es mit nur schriftlichem Info-Material nicht getan. Dazu gehört unbedingt auch die lebendige direkte Diskussion am Ort. Hier liegt ein gut Stück Hoffnung nach wie vor darin, daß ihr alle aktiv werdet. Eine erste flüchtige Sammlung von Adressen für den WANDELSBLATT-Versand hat schon alleine über 2.000 Betriebe ,,gebracht", darunter mehr als die Hälfte Läden. Ob Naturkostläden, Buchläden, 3.Welt-Läden, Boutiquen, Cafes, Kinos, Kneipen - ihr alle habt Publikumsverkehr und die meisten von euch haben längst intensivere Kontakte mit ehemaligen ,,Nur-Kunden" hergestellt. Wenn ihr diese Kontakte jetzt der Bewegung - euch recht unmittetbar selbst also - zur Verfügung stellt, wenn ihr bei euch die Diskussion um die Bankgründung und die Notwendigkeit der Eigenkapitalsammlung führt, dann ist dies der beste und effektivste Weg, mit dieser Sache zum Ziel zu kommen. Der beste deswegen, weil es der Bank nur gut tun kann, wenn ihre ursprünglichen Kapitalgeber aus dem unmittelbaren Umfeld der Betriebe kommen. Das wird viele Diskussionen, die später zu führen sind (Risikobereitschaft der Bank, Entwicklung von Kriterien besonderer Förderungswürdigkeit, d.h. Zinsverbilligung etc.) erheblich vereinfachen. Unmittelbares Ergebnis der Gespräche zwischen Stattwerke regionalen Netzwerken und dem Öko-Bank-Freundeskreis bei der Projektmesse war die Entscheidung, diesen Verein Freunde und Förderer so bald wie möglich zu dezentralisieren, d.h. zu regionalisieren.  Gewünscht ist der folgende Ablauf: Regional schließen sich Freunde und
Förderer der Öko-Bank zusammen, führen die Diskussion um die Ausgestaltung der Bank,
betreiben die Öffentlichkeitsarbeit, versuchen insbesondere, alle relevanten
Gruppierungen der Region in die aktive Mitarbeit mit einzubeziehen und möglichst intensiv
Gelder auf das Treuhandkonto zu sammeln.
Sobald neun solcher
Regionalvereine arbeitsfähig sind, wird die Satzung des Gesamt-Vereins so verändert,
daß es den jetzigen zentralen Vorstand nicht mehr gibt. Der Vorstand setzt sich dann
zusammen aus gewählten Vertretern der Regionen, proportional nach deren
Mitgliederstärke. Vorstandssitzungen gewinnen damit den Charakter von Vertreter-Tagen,
bei denen Impulse aus den Regionen eingebracht und in die jeweils anderen Regionen
rückvermittelt werden können.
Kriterien für die
Arbeitsfähigkeit sind inhaltlicher und praktischer Art: Keine an der Mitarbeit
interessierte Gruppierung der Bewegung darf ausgeklammert werden; der Regionalverein muß
100.000 Mark Treugelder gesammelt haben und mindestens 100 Mitglieder zählen (die Zahlen
haben damit was zu tun, daß zur Arbeitsfähigkeit dazugehört, regional ein Büro mit
einem Menschen besetzt betreiben zu können).
Unser Aufruf an euch ist
daher, solche regionale Arbeit zu initiieren bzw. euch schon bestehenden Initiativen
anzuschließen, damit die Demokratisierung auch der Vorläufer der Bank-Strukturen
möglichst bald vollzogen werden kann.
Wer es ernst meint mit der
Kritik, es werde viel zu viel (,,nur noch") über Geld geredet, der sollte sich an
die Arbeit machen, die beschriebenen Selbstfinanzierunginstrumente mit aufzubauen. Damit
wir dieses Thema in 2 Jahren als erledigt abhaken können.
Geld wird zwar auch dann
noch Thema sein, in den Gruppen und bei Gruppentreffen - aber nicht mehr in der
drückenden, belastenden Form wie derzeit.
Wir drucken die
Beitrittserklärung zum Verein und als Kapitalgeber für die
Öko-Bank hier nochmal ab, damit ihr's einfacher habt, einzusteigen. Eine einfache Post-
und/oder Zahlkarte tut's aber auch.
An die Läden nochmal der
Hinweis, daß es eine Informationsbroschüre zur Öko-Bank gibt, in der kurz das
Wesentliche beschrieben ist. Diese Broschüre (und entsprechende Plakate) könnt ihr beim
Frankfurter Öko-Bank-Büro anfordern. Vom Verkaufspreis (1,50 DM) könnt ihr 30%
einbehalten. Schöner ist natürlich, ihr vertreibt die Broschüre aus Solidarität und
rechnet in voller Höhe ab. Das Geld für die Öffentlichkeitsarbeit kommt aus den
Mitgliederbeiträgen und den Zinsen der schon gesammelten Treugelder und reicht hinten und
vorne nicht.
Hier die Bezugsadresse: Gewünscht ist der folgende Ablauf: Regional schließen sich Freunde und
Förderer der Öko-Bank zusammen, führen die Diskussion um die Ausgestaltung der Bank,
betreiben die Öffentlichkeitsarbeit, versuchen insbesondere, alle relevanten
Gruppierungen der Region in die aktive Mitarbeit mit einzubeziehen und möglichst intensiv
Gelder auf das Treuhandkonto zu sammeln.
Sobald neun solcher
Regionalvereine arbeitsfähig sind, wird die Satzung des Gesamt-Vereins so verändert,
daß es den jetzigen zentralen Vorstand nicht mehr gibt. Der Vorstand setzt sich dann
zusammen aus gewählten Vertretern der Regionen, proportional nach deren
Mitgliederstärke. Vorstandssitzungen gewinnen damit den Charakter von Vertreter-Tagen,
bei denen Impulse aus den Regionen eingebracht und in die jeweils anderen Regionen
rückvermittelt werden können.
Kriterien für die
Arbeitsfähigkeit sind inhaltlicher und praktischer Art: Keine an der Mitarbeit
interessierte Gruppierung der Bewegung darf ausgeklammert werden; der Regionalverein muß
100.000 Mark Treugelder gesammelt haben und mindestens 100 Mitglieder zählen (die Zahlen
haben damit was zu tun, daß zur Arbeitsfähigkeit dazugehört, regional ein Büro mit
einem Menschen besetzt betreiben zu können).
Unser Aufruf an euch ist
daher, solche regionale Arbeit zu initiieren bzw. euch schon bestehenden Initiativen
anzuschließen, damit die Demokratisierung auch der Vorläufer der Bank-Strukturen
möglichst bald vollzogen werden kann.
Wer es ernst meint mit der
Kritik, es werde viel zu viel (,,nur noch") über Geld geredet, der sollte sich an
die Arbeit machen, die beschriebenen Selbstfinanzierunginstrumente mit aufzubauen. Damit
wir dieses Thema in 2 Jahren als erledigt abhaken können.
Geld wird zwar auch dann
noch Thema sein, in den Gruppen und bei Gruppentreffen - aber nicht mehr in der
drückenden, belastenden Form wie derzeit.
Wir drucken die
Beitrittserklärung zum Verein und als Kapitalgeber für die
Öko-Bank hier nochmal ab, damit ihr's einfacher habt, einzusteigen. Eine einfache Post-
und/oder Zahlkarte tut's aber auch.
An die Läden nochmal der
Hinweis, daß es eine Informationsbroschüre zur Öko-Bank gibt, in der kurz das
Wesentliche beschrieben ist. Diese Broschüre (und entsprechende Plakate) könnt ihr beim
Frankfurter Öko-Bank-Büro anfordern. Vom Verkaufspreis (1,50 DM) könnt ihr 30%
einbehalten. Schöner ist natürlich, ihr vertreibt die Broschüre aus Solidarität und
rechnet in voller Höhe ab. Das Geld für die Öffentlichkeitsarbeit kommt aus den
Mitgliederbeiträgen und den Zinsen der schon gesammelten Treugelder und reicht hinten und
vorne nicht.
Hier die Bezugsadresse:
Verein Freunde + Förderer der
Ökobank e.V
Anzeige der Ökobankinitiative in Wandelsblatt Oktober 1984 Der oben formulierte Anspruch ließ sich ab 1988 (kurz vor Gründung der Bank) nicht durchhalten. Die Ökobank ging ihre eigenen Wege bis zum Ende ... (23.8.2000) |
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser
Website an: CONTRASTE
|