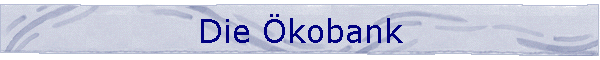|
| |
Der „historische" Kompromiß:
Die Ökobank
kommt!
Nach monatelangem Tauziehen
um die Ökobank erwartete das Publikum der Diskussionsveranstaltung um die Ökobank auf
der Projektmesse nun ein bißchen mehr Klarheit über die verschiedenen Positionen. Denn -
wie so häufig im Vorfeld solcher Projekte - fanden die wichtigsten Diskussionen im
kleinen Kreis statt. Doch was kam, waren zwei friedlich nebeneinander sitzende Fraktionen,
die sich kurz vorher doch noch geeinigt hatten. Wie schon die wichtigsten
Diskussionspunkte in dem Konflikt (der z.B. an Tarifauseinandersetzungen erinnerte) nicht
entschleiert wurden, war nun auch der Hintergrund für die (scheinbar) plötzliche
Einigung nicht erkennbar. Das unterschwellige Unbehagen in den Zuschauerreihen war dann
auch sehr berechtigt. Um nun
mehr Licht in das Dunkel alternativer Finanzstrategien zu bringen, soll hier kurz die
Entwicklung dargestellt werden.

Wie alles anfing...
Die Diskussion in der
Szene um das Geld ist so alt wie die Szene selbst. Auch ist die Idee von der Alternativen
Bank immer mal wieder in die Diskussion geworfen worden. Konkrete Ansätze, das
Geldproblem anzugehen, entwickelten sich zunächst mal auf der Spendenschiene (Netzwerke,
Ökofonds) und inzwischen gibt es auch schon alternative Kreditvermittlungen (STATTwerke),
über die private Spargelder in finanzierungsbedürftige Projekte geleitet werden. Als
dann im letzten Herbst, dem Raketenherbst, auch die Geschäftspolitik der Banken wieder
thematisiert wurde, kam auch das Thema „Alternativbank" wieder in die
Schlagzeilen (zumindest in der TAZ) und damit ins Bewußtsein der Szene. Und gemäß der
politischen Entwicklung der letzten Jahre wurde das Kind „Ökobank" getauft. Es
bildete sich eine Initiative (wie der Zufall es wollte. in der Bankenmetropole Frankfurt),
die den Aufbau dieser Bank betreiben wollte.
Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, daß
diese Initiative von den anderen Gruppen (Netzwerke, STATTwerke), die im alternativen
Finanzierungsdschungel arbeiten, euphorisch aufgenommen und unterstützt wird. Nicht so in
unserer konfliktfreudigen Szene. Erstmal war den Netz- und STATTwerkern verdächtig, daß
so eine Initiative nicht aus den eigenen Reihen kommt und dann störte sie die
Hau-Ruck-Mentalität einiger Öko-Bank-Initiatoren.

Der Konflikt bricht
auf
Von Anfang an
fighteten beide Parteien ziemlich verbissen um die besseren Finanzstrategien. Zunächst
war die Konfliktlinie klar: Die Ökobank-Initiative wollte eine Bank, und zwar möglichst
schnell, während die Netz- und STATTwerke auf ihren bankähnlichen Konzepten beharrten
und eine Bank aus strukturellen Erwägungen ablehnten.
Trotz sehr harter Auseinandersetzung und
wenig Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, blieb man in der Diskussion. Doch die
Verhärtung war nur äußerlich und schließlich wurde auf der einen Seite die strikte
Anti-Bank-Haltung aufgegeben und auf der anderen Seite die Notwendigkeit der
Berücksichtigung bankähnlicher Finanzstrukturen eingesehen. Im folgenden verschob sich
der Streit auf das Problem des „richtigen, szeneangemessenen" Bankkonzeptes. Und
dies war dann auch mehr und mehr ein Expertenstreit, der nach außen nicht so einfach
nachvollziehbar ist.

Was ist
Dezentralität?
Inhaltlich lagen die Streitpunkte bei der
Organisation der Bank, der Grad der Dezentralität und der Kontrollmöglichkeiten durch
die „Basis".
Das Bankkonzept der Öko-Bank-Initiative sah
vor, daß die Träger dieser Bank (sprich: Genossen) Privatpersonen, Gruppen und Projekte
sind. Aufgrund der hohen Anzahl der Genossen müssen Vertreter bestimmt werden, die dann
in den Generalversammlungen (der Bank) die Politik bestimmen und den Vorstand bzw.
Aufsichtsrat wählen und abwählen. Somit wäre die demokratische Kontrolle gesichert.
Neben der Zentrale (nicht mehr so zufällig in Frankfurt geplant) sollte es sogenannte
„Repräsentanzen" in den Regionen geben, die die Bankgeschäfte vor Ort
erledigen. Diese Repräsentanzen sollen eng mit den Gruppen und Projekten vor Ort
zusammenarbeiten und von denen kontrolliert werden.
Dem stellten die STATT- und Netzwerker
folgendes Konzept entgegen: Die bereits entwickelten und sich entwickelnden Strukturen im
Finanzierungsbereich werden weiter ausgebaut und es werden regionale
Finanzierungsgesellschaften, sogenannte Finanzkooperativen gegründet, in denen alle
Finanzierungsinstrumente integriert sind. Diese Finanzkooperativen, deren Träger
Projekte, politische Gruppen und engagierte Einzelpersonen sein sollen, sollen dann für
sich Eigenkapital ansammeln, das dann en bloc als Genossenschaftsantei1 in die Bank
eingebracht wird. Die Bank hat dann 8-15 Genossen (Regionen/ Finanz-Koops), die die
Rahmenbedingungen für die Bank bestimmen. Die Geschäftspolitik und die Bankgeschäfte
selbst sind dann den Kooperativen überlassen, die weitgehend autonom sind und neben der
Kreditvermittlung auch das institutionelle Bankgeschäft betreiben. Formalrechtlich wären
diese Koops dann gleichzeitig Filialen der Ökobank mit einem voll verantwortlichen (der
Ökobank gegenüber) Prokuristen.

Der
„historische" Kompromiß
Natürlich gab und gibt es auch innerhalb
der Ökobank-Initiative keine einheitliche Meinung. Jedoch fand sich eine Mehrheit für
die grundsätzliche Akzeptierung des STATT/Netzwerkekonzeptes. Beide Parteien
verständigten sich auf das Modell der Finanzkooperativen unter der Bedingung, daß dieses
Konzept rechtlich machbar und ökonomisch sinnvoll ist. Anders ausgedrückt: Grundlage
für weitere Diskussionen ist das Finanz-Kooperativen-Modell, von dem bei der Umsetzung
nur in dem Maß abgewichen wird, wie dies rechtliche und ökonomische Bedingungen
(nachvollziehbar) erfordern. Außerdem sollte durch Netz/STATTwerke sichergestellt werden,
daß durch eine solche Regionalisierung der Gründungsprozeß nicht hinausgezögert und
verkompliziert wird.
Diese Regionalisierung wird nun auch in der
Struktur der Ökobank-Initiative, dem Verein der Freunde und Förderer der Ökobank,
vorweggenommen. Zur Zeit werden allerortens regionale Fördervereine gegründet - als
Vorläufer der Finanz-Koops - die dann, sobald sie rechtsfähig sind, in den Frankfurter
Verein eintreten werden und diesen dann zu ihrem Dachverband umfunktionieren.

...und war hat das
mit der Basis zu tun?
Auch das regionale, basisnahe Konzept kann
nicht darüber hinweg täuschen, daß sich hier die zukünftigen Finanzmanager der Szene
fetzen - und aufkommende Macht- und Geldphantasien kann wohl keiner der Beteiligten
leugnen (ob nun im eigenen oder Projektinteresse). Auch STATT- und Netzwerke können sich
damit brüsten, die Interessen der Basis durchgesetzt zu haben, was allerdings geschaffen
wurde, ist eine Situation, die es interessierten Projekten und Gruppen ermöglicht, sich
regional in die Diskussion um die Ökobank einzuklinken (was sicherlich einfacher ist als
einmal im Monat nach Frankfurt zu fahren). Das Konzept sieht eine starke Basisanbindung
vor. Ob es allerdings mit dem Leben gefüllt wird, wie es sich seine Protagonisten
vorstellen, das liegt am Engagement eben der betroffenen Projekte und Gruppen.
Was bleibt ist, daß wir weder eine Bank
für noch der Bewegung wollen, sondern eine „bewegte" Bank.

Nachtrag für
Schaulustige
Dieser Kompromiß ist kein einhelliger! Es
gibt durchaus auch die (Minderheits-)Meinung, daß vieles an dem Konzept einer notwendigen
Bankseriosität schaden würde und somit viele potente Geldgeber verschreckt. Und diese
Minderheit könnte tatsächlich zu einer Sperrminorität werden, da die umfangreichen
Struktur- und Satzungsänderungen, die für das neue Konzept notwendig werden, einer
qualifizierten (3/4) Mehrheit bedürfen. Im schlimmsten Fall - d.h. wenn es eine
Auseinandersetzung auf der formaljuristischen Ebene gibt - müßten die
Regionalinitiativen einen neuen Dachverband gründen und es würde zwei konkurrierende
Bankinitiativen geben. Der interessierte Zuschauer darf also noch ein bißchen gespannt
sein.
Michael Makowski
Der Autor ist Mitarbeiter der STATTwerke und
als solcher direkt an den Auseinandersetzungen beteiligt. Die Objektivität der
Berichterstattung ist nur scheinbar. Subjektivistische Tendenzen ließen sich nicht
ausschließen.
M.M. |